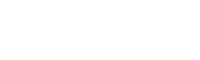Unfälle im Straßenverkehr sind an der Tagesordnung – laut Statistischem Bundesamt ereignen sich in Deutschland pro Jahr über 2,5 Millionen Verkehrsunfälle. Besonders für Gründer und Selbstständige kann schon ein kleiner Auffahrunfall weitreichende Folgen haben. Fällt das eigene Fahrzeug aus, drohen Arbeitsausfälle und finanzielle Einbußen. Schnelle Unfallgutachten helfen dabei, die Schadenregulierung zügig voranzutreiben und somit Mobilitätsverluste und wirtschaftlichen Schaden zu minimieren. Dieser Artikel beleuchtet ausführlich, warum eine rasche Begutachtung nach einem Unfall gerade in Berlin so entscheidend ist, wie ein Unfallgutachten abläuft und welche typischen Stolperfallen es bei der Unfallabwicklung zu vermeiden gilt.
Inhaltsverzeichnis
- Warum eine schnelle Schadensregulierung für Selbstständige und Gründer so wichtig ist
- Wie ein Unfallgutachten abläuft (Schritte und Inhalte)
- Vorteile unabhängiger Gutachter gegenüber Versicherungs-Gutachtern
- Typische Fehler bei der Unfallabwicklung vermeiden
- Die Rolle des Unfallgutachtens im Versicherungsprozess
- Fazit: Schnell handeln und professionellen Rat nutzen
1. Warum eine schnelle Schadensregulierung für Selbstständige und Gründer so wichtig ist
Für Selbstständige und Firmengründer gilt das Motto Zeit ist Geld in besonderem Maße. Gerät man unverschuldet in einen Unfall, zählt jede Stunde: Während ein Angestellter vielleicht auf ein Ersatzfahrzeug des Arbeitgebers zurückgreifen kann, steht der Selbstständige oft ohne Alternative da. Arbeitsausfall bedeutet unmittelbar Einnahmeausfall – Aufträge können nicht wahrgenommen werden, Termine müssen verschoben oder abgesagt werden. Die Fixkosten (z.B. Leasingrate des Fahrzeugs, Versicherungen) laufen derweil weiter. Eine schnelle Schadensregulierung ist daher essentiell, um die finanzielle Durststrecke so kurz wie möglich zu halten.
Besonders die Mobilität spielt eine zentrale Rolle: Viele Unternehmer sind auf ihr Fahrzeug angewiesen, um Kunden zu erreichen oder Material zu transportieren. Fällt das Auto länger aus, kann das Geschäft praktisch zum Stillstand kommen. Zwar übernimmt die Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers grundsätzlich auch Folgekosten wie entgangenen Gewinn oder Mietwagenkosten, doch diese Leistungen fließen erst nachträglich. In der Zwischenzeit muss der Selbstständige improvisieren und ggf. in Vorleistung gehen. Je schneller also das Unfallgutachten vorliegt und die Ansprüche bei der Versicherung geltend gemacht werden können, desto schneller erhält man Ersatz für Verdienstausfall oder einen gestellten Mietwagen bzw. Nutzungsausfallentschädigung. Eine zügige Gutachtenerstellung beschleunigt letztlich die gesamte Schadensregulierung, was die wirtschaftlichen Schäden für Betroffene erheblich begrenzen kann.
Nicht zu unterschätzen ist auch der Stressfaktor: Ein ungeklärter Schadenfall bindet Aufmerksamkeit und Energie, die Gründer eigentlich für den Aufbau ihres Geschäfts brauchen. Hängt der Fall wochenlang in der Luft, weil etwa das Gutachten fehlt, leidet darunter auch die Konzentration aufs Kerngeschäft. Daher zahlt es sich aus, sofort nach dem Unfall alle notwendigen Schritte einzuleiten – angefangen bei einer schnellen Begutachtung des Schadens – um möglichst bald wieder volle Handlungsfähigkeit zu erlangen.
2. Wie ein Unfallgutachten abläuft (Schritte und Inhalte)
Ein Unfallgutachten wird typischerweise von einem unabhängigen Kfz-Sachverständigen erstellt und folgt einem klaren Ablauf. Im Folgenden die wichtigsten Schritte und Inhalte eines solchen Gutachtens:
- Beauftragung des Gutachters: Nach dem Unfall kontaktiert der Geschädigte einen Kfz-Gutachter seines Vertrauens. Bei Fremdverschulden hat man das Recht, selbst einen unabhängigen Sachverständigen zu wählen – die Kosten trägt in der Regel die gegnerische Versicherung. Der Gutachter vereinbart kurzfristig einen Termin, oft innerhalb von 24–48 Stunden, um den Schaden aufzunehmen.
- Fahrzeugbesichtigung und Schadenaufnahme: Der Sachverständige besichtigt das beschädigte Fahrzeug gründlich. Dies kann am Unfallort, beim Geschädigten zu Hause oder in einer Werkstatt erfolgen. Alle sichtbaren Schäden werden dokumentiert. Der Gutachter macht Fotos aus verschiedenen Perspektiven, nimmt Maße und notiert sich technische Details. Gegebenenfalls wird die Karosserie teilweise demontiert, um verdeckte Schäden (z.B. an tragenden Teilen oder der Achse) zu erkennen. Auch Begleitschäden wie ausgelöste Airbags oder Flüssigkeitsverlust werden erfasst.
- Datenerfassung und Fahrzeugdaten: Zum Unfallgutachten gehört auch die Erfassung aller relevanten Fahrzeugdaten. Der Gutachter notiert Fabrikat, Modell, Baujahr, Kilometerstand, Vorzustand des Wagens und etwaige Vorschäden. Diese Infos sind wichtig, um den Wiederbeschaffungswert – also den Wert des Fahrzeugs vor dem Unfall – bestimmen zu können.
- Schadensbewertung und Kalkulation: Auf Grundlage der aufgenommenen Schäden kalkuliert der Sachverständige die voraussichtlichen Reparaturkosten. Dabei greift er auf Reparaturleitfäden, Arbeitszeitkataloge und Ersatzteilpreise der Hersteller zurück. Er berücksichtigt Lackierarbeiten, Ersatzteile, Arbeitslohn der Werkstatt und eventuelle Zusatzarbeiten (z.B. Achsvermessung). Zudem schätzt er die voraussichtliche Reparaturdauer in Tagen – wichtig für die Frage, wie lange ein Mietwagen oder Nutzungsausfall gezahlt werden müsste.
- Beurteilung wirtschaftlicher Totalschaden: Falls der Schaden sehr hoch ist, prüft der Gutachter, ob ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt. Dazu wird der Wiederbeschaffungswert (Marktwert des Fahrzeugs vor dem Unfall) dem Reparaturkostenaufwand gegenübergestellt. Übersteigen die Reparaturkosten den Wert des Autos (ggf. unter Berücksichtigung einer Totalschaden-Grenze, meist etwa 125 % des Wiederbeschaffungswertes), liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden vor. In diesem Fall ermittelt der Sachverständige zusätzlich den Restwert des Unfallwagens – also den Betrag, den ein Restwertaufkäufer oder Verwerter für das beschädigte Fahrzeug noch zahlen würde. Laut Verbraucherzentrale wird dieser Restwert vom Gutachter anhand aktueller Marktplattformen oder Restwertbörsen ermittelt. Diese Werte (Wiederbeschaffungswert und Restwert) dienen später der Versicherung zur Berechnung der Entschädigungssumme im Totalschadensfall.
- Gutachtenerstellung und Dokumentation: Alle gewonnenen Informationen fließen in das schriftliche Unfallgutachten ein. Dieses enthält eine detaillierte Schadenbeschreibung, Fotos der Schäden, die Kalkulation der Reparaturkosten, die Reparaturdauer, Angaben zum Fahrzeugwert vor dem Unfall und zum Restwert (falls relevant) sowie ggf. eine Stellungnahme zur Unfallursache oder Plausibilität des Schadenhergangs. Das Gutachten umfasst meist mehrere Seiten und liefert eine transparente Grundlage für die Schadenregulierung.
- Übermittlung und Besprechung: Der fertige Gutachtenbericht wird dem Auftraggeber (Geschädigten) ausgehändigt und bei Bedarf direkt an die Versicherung oder den Rechtsanwalt weitergeleitet. Ein guter Gutachter erklärt dem Geschädigten auch die Ergebnisse: z.B. ob Reparatur oder eher Ersatzbeschaffung sinnvoll ist. Mit dem Gutachten in der Hand kann der Geschädigte seine Ansprüche gegenüber dem Unfallgegner fundiert beziffern.
Durch diesen strukturierten Ablauf stellt das Unfallgutachten sicher, dass kein Aspekt des Schadens übersehen wird. Gerade für Laien ist vieles nicht sofort ersichtlich – der Sachverständige hingegen erkennt auch versteckte Mängel und beziffert den Schaden objektiv. Wichtig zu wissen: Das Gutachten ist nicht gleichzusetzen mit einem Kostenvoranschlag einer Werkstatt. Es ist wesentlich detaillierter und unabhängiger, wodurch es als Beweismittel im Versicherungsfall dient. Insgesamt dauert die Erstellung eines Unfallgutachtens nach der Besichtigung oft nur wenige Tage – ein entscheidender Vorteil, um schnell Klarheit über die Schadenhöhe zu erhalten.
3. Vorteile unabhängiger Gutachter gegenüber Versicherungs-Gutachtern
Nach einem Unfall bietet die gegnerische Versicherung häufig an, selbst einen Gutachter zu stellen oder den Schaden in einer Partnerwerkstatt begutachten zu lassen. Was auf den ersten Blick bequem erscheint, ist für Geschädigte nicht immer von Vorteil. Ein unabhängiger Gutachter, den man selbst beauftragt, bringt einige handfeste Vorteile mit sich:
- Interessenvertretung des Geschädigten: Ein unabhängiger Sachverständiger arbeitet im Auftrag des Unfallopfers und wahrt dessen Interessen. Im Gegensatz dazu steht ein vom Versicherer beauftragter Gutachter letztlich in dessen Diensten. Versicherungen haben ein natürliches Interesse daran, die Regulierungskosten niedrig zu halten. Ein eigener Gutachter des Geschädigten wird den Schaden daher tendenziell großzügiger und gründlicher aufnehmen, während ein Versicherungs-Gutachter möglicherweise versucht, bestimmte Positionen (etwa geringfügige Kratzer oder Folgeschäden) kleinzureden.
- Umfang und Gründlichkeit der Begutachtung: Unabhängige Gutachter nehmen sich in der Regel mehr Zeit für die Untersuchung des Fahrzeugs. Sie prüfen jedes Detail und dokumentieren sämtliche Schadenpunkte. Ein Versicherungs-Gutachter hingegen könnte zeitlich straffer eingebunden sein und möglicherweise nicht jedes Detail festhalten, das aber später teuer werden könnte. Beispielsweise wird ein freier Sachverständiger auch auf Wertminderung des Fahrzeugs nach der Reparatur eingehen – also den Minderwert, der verbleibt, weil das Auto nun einen Unfallschaden in der Historie hat. Solche Punkte kommen geschädigten Haltern zugute, da sie ebenfalls erstattet werden können, und werden im unabhängigen Gutachten daher berücksichtigt.
- Schnelligkeit und Flexibilität: Selbstständige Kfz-Gutachter (oft Ingenieurbüros oder Sachverständigenorganisationen wie GTÜ, KÜS, TÜV oder DEKRA) sind in Großstädten meist innerhalb kürzester Zeit verfügbar. Man erhält oft noch am Unfalltag oder Folgetag einen Termin. Versicherungsgutachter dagegen werden vom Versicherer beauftragt, was organisatorisch dauern kann – wertvolle Zeit, in der das eigene Fahrzeug bereits ungenutzt rumsteht. Mit einem unabhängigen Gutachter hat man das Gutachten oft früher auf dem Tisch und kann die Regulierung anstoßen.
- Unabhängigkeit und Beweissicherung: Im Falle von Streitigkeiten – etwa wenn die gegnerische Versicherung später doch kürzen will – hat man mit einem eigenen Gutachten ein unabhängiges Beweismittel in der Hand. Dieses kann notfalls vor Gericht verwendet werden. Hätte man sich allein auf das Gutachten der Versicherung verlassen, wäre man bei Differenzen im Nachteil, da man kein eigenes Dokument zum Gegenbeweis vorlegen könnte. Der unabhängige Gutachter stärkt also die Rechtsposition des Geschädigten.
- Kostenübernahme durch Versicherung: Bei einem unverschuldeten Unfall mit nennenswertem Schaden (i.d.R. oberhalb der Bagatellgrenze von ca. 750 €) muss die gegnerische Versicherung die Kosten des vom Geschädigten beauftragten Gutachters übernehmen. Für Selbstständige und Gründer ist dies wichtig zu wissen – man scheut eventuell die vermeintlichen Kosten eines eigenen Sachverständigen, aber diese werden im Haftpflichtfall regulär als Teil des Schadens geltend gemacht. Somit erhält man die Vorteile der unabhängigen Begutachtung ohne selbst auf den Kosten sitzen zu bleiben.
Zusammengefasst ermöglichen unabhängige Gutachter eine transparente und faire Schadenfeststellung. Verbraucherorganisationen raten daher oft, im Haftpflichtfall von seinem Recht Gebrauch zu machen, einen eigenen Gutachter zu beauftragen, anstatt sich allein auf den Versicherer zu verlassen. So stellt man sicher, dass kein Schadenaspekt unter den Tisch fällt und die Regulierung später auf Augenhöhe erfolgt.
4. Typische Fehler bei der Unfallabwicklung vermeiden
Ein Verkehrsunfall ist für alle Beteiligten eine Ausnahmesituation. In der Hektik nach dem Crash werden leicht Fehler gemacht, die die spätere Schadenabwicklung erschweren können. Insbesondere Selbstständige, die auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, sollten folgende typische Fehler vermeiden:
- Fehler 1: Unfall nicht ausreichend dokumentieren: Versäumen Sie nicht, den Unfallort und die Schäden ausführlich zu dokumentieren. Oft sind Unfallbeteiligte im Schock und möchten die Straße schnell wieder räumen. Doch ohne Fotos von beiden Fahrzeugen, der Endposition, Bremsspuren etc. fehlt später wichtiges Beweismaterial. Notieren Sie Namen und Kontaktdaten von Zeugen. Ein europäischer Unfallbericht (Formular) kann helfen, die Situation festzuhalten. Wer darauf verzichtet, riskiert Streitigkeiten über den Hergang und Umfang der Schäden.
- Fehler 2: Keine Polizei rufen (obwohl nötig): Bei größeren Schäden oder Unklarheiten zur Schuldfrage sollte unbedingt die Polizei hinzugezogen werden. In Berlin mag die Wartezeit auf die Polizei bei Blechschäden manchmal lang sein, doch ein polizeiliches Protokoll kann später Gold wert sein – etwa wenn der Unfallgegner seine Aussage ändert oder sich Herausstellungen ergeben. Bei Personenschäden, Streit oder wenn der Unfallgegner flüchtet, ist die Polizei sowieso Pflicht. Viele machen den Fehler, aus Bequemlichkeit oder Zeitdruck nicht zu telefonieren; das kann sich später rächen.
- Fehler 3: Angaben gegenüber der Versicherung unvollständig oder vorschnell machen: Melden Sie den Unfall zügig Ihrer Versicherung (auch wenn Sie Geschädigter sind, sollte die eigene Haftpflicht informiert werden). Bleiben Sie dabei aber sachlich und machen Sie keine Spekulationen oder Schuldeingeständnisse. Ein häufiger Fehler ist, im Eifer des Gefechts ungenaue oder überstürzte Aussagen zu machen, die dann so zu Protokoll genommen werden. Im Zweifel konsultieren Sie lieber einen Anwalt, bevor Sie schriftliche Aussagen abgeben. Wichtig: Als Geschädigter müssen Sie sich nur mit der gegnerischen Versicherung in Verbindung setzen, nicht mit deren Fragenkatalogen sofort ausführlich alles beantworten, was eventuell missinterpretiert werden könnte.
- Fehler 4: Verzicht auf eigenen Gutachter oder Anwalt aus Kostengründen: Wie oben ausgeführt, werden die Kosten für einen eigenen Gutachter und in der Regel auch für einen Anwalt vom Unfallgegner getragen, sofern Sie keine Schuld tragen. Viele verzichten jedoch darauf, weil sie denken, es ginge auch ohne. Das ist ein Fehler, denn ohne unabhängige Beratung laufen Sie Gefahr, Ansprüche zu übersehen. Beispielsweise kennen manche Geschädigte den Anspruch auf Nutzungsausfall nicht und nehmen kein Geld für die Tage ohne Fahrzeug, obwohl ihnen das zusteht. Ein Anwalt und Sachverständiger weisen Sie auf solche Punkte hin. Sparen Sie also nicht am falschen Ende – Ihre berechtigten Ansprüche gehen sonst verloren.
- Fehler 5: Schnellabfindung unterschreiben: Versicherungen bieten manchmal eine schnelle, pauschale Zahlung an, wenn man im Gegenzug auf alle weiteren Ansprüche verzichtet (Abfindungserklärung). Solche Angebote sollte man ohne genaue Prüfung nie vorschnell unterschreiben. Es könnten später noch Reparaturmehrkosten, Wertminderung oder gesundheitliche Spätfolgen auftreten. Wer dann auf weitere Ansprüche verzichtet hat, schaut in die Röhre. Also: Erst unterschreiben, wenn wirklich alle Schäden bekannt und reguliert sind.
- Fehler 6: Kommunikation und Fristen verschlampen: Ein Unfall bringt Papierkram mit sich. Ein häufiger Fehler ist, wichtige Fristen zu versäumen – etwa die Unfallmeldung nicht innerhalb der vertraglich geforderten Zeit bei der eigenen Versicherung einzureichen. Auch sollten Schreiben der gegnerischen Versicherung nicht ignoriert werden. Bleiben Sie proaktiv: Fragen Sie z.B. nach zwei Wochen ohne Rückmeldung bei der Versicherung nach dem Stand. Lassen Sie den Vorgang nicht einfach laufen in der Hoffnung, „wird schon“. Wer die Zügel aus der Hand gibt, erlebt mitunter unangenehme Verzögerungen oder Kürzungen.
Indem man diese Fehler vermeidet, legt man den Grundstein für eine reibungslosere Schadenabwicklung. Vorbereitung ist alles: Viele führen z.B. einen Unfallbogen und Kamera (heutzutage Smartphone) im Auto mit, um im Ernstfall gerüstet zu sein. Gründer und Selbstständige sollten sich im eigenen Interesse über ihre Rechte im Klaren sein – dann läuft die Regulierung deutlich effizienter.
5. Die Rolle des Unfallgutachtens im Versicherungsprozess
Nachdem der Gutachter das Unfallgutachten erstellt hat, kommt diesem Dokument im weiteren Versicherungsprozess eine zentrale Rolle zu. Es bildet die Grundlage für die Schadenregulierung gegenüber dem Versicherer des Unfallgegners (bzw. der eigenen Kaskoversicherung, falls man selbst schuld war und einen Kaskoschaden geltend macht). Doch was genau passiert, sobald das Gutachten vorliegt?
Zunächst wird das Gutachten an die zuständige Versicherung übermittelt – im Haftpflichtfall also an den Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers. Viele Geschädigte übergeben das Gutachten zusammen mit allen Unterlagen an einen Rechtsanwalt, der sich um die Kommunikation mit der Versicherung kümmert. Alternativ kann man es selbst mit einem Anschreiben einreichen. Die Versicherung prüft dann das Gutachten. In den meisten Fällen wird ein sorgfältig erstelltes Gutachten von der Versicherung akzeptiert, da es von einem qualifizierten Sachverständigen stammt und alle relevanten Positionen enthält.
Auf Basis des Gutachtens entscheidet die Versicherung, welche Leistungen sie erbringen muss. Beispielsweise erkennt sie daraus, ob das Fahrzeug repariert werden kann oder ob ein Totalschaden vorliegt. Liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden vor, zahlt die Haftpflichtversicherung in der Regel den Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert des Fahrzeugs. Diese Werte wurden im Gutachten ermittelt und ermöglichen der Versicherung eine klare Berechnung der Entschädigungssumme. Muss das Auto repariert werden, erstattet die Versicherung die veranschlagten Reparaturkosten (sofern sie angemessen und ortsüblich sind, was durch das Gutachten belegt ist). Die Reparaturwerkstatt kann sich bei Unklarheiten ebenfalls am Gutachten orientieren und weiß, welche Teile zu ersetzen sind.
Darüber hinaus belegt das Gutachten die Reparaturdauer, die benötigt wird. Dies ist wichtig für sogenannte Folgekosten: Während der Wagen in der Werkstatt ist, hat der Geschädigte Anspruch auf einen Mietwagen oder Nutzungsausfallentschädigung. Die Versicherung entnimmt dem Gutachten die voraussichtliche Reparaturzeit (z.B. 5 Tage) und weiß somit, für wie viele Tage sie diese Kosten übernehmen muss. Gleiches gilt für eine eventuelle Wertminderung des Fahrzeugs nach der Reparatur – das Gutachten gibt an, ob und in welcher Höhe ein merkantiler Minderwert besteht, den der Versicherer ausgleichen muss.
Man kann sich das Unfallgutachten also als eine Art Fahrplan für die Versicherung vorstellen. Ohne Gutachten würde die Versicherung möglicherweise einen eigenen Schätzer schicken oder auf einen einfachen Kostenvoranschlag einer Werkstatt bestehen, der aber weniger umfassend ist. Mit dem Gutachten hingegen liegen alle Fakten schwarz auf weiß vor: die Schadenhöhe, technische Details, Werte und Kosten. Das beschleunigt den Prozess, weil Rückfragen minimiert werden. Sollte die Versicherung dennoch Zweifel haben (etwa an der Höhe der veranschlagten Kosten), müsste sie ein Gegengutachten einholen. Doch bei seriösen, unabhängigen Gutachten ist das selten – häufig werden solche nur bei sehr hohen Schadensummen oder Unklarheiten beauftragt.
Für den Selbstständigen oder Gründer bedeutet ein gutes Unfallgutachten Sicherheit: Man hat seine Forderungen ordentlich beziffert und kann sie belegbar einfordern. Falls die Versicherung trödelt oder versucht, etwas abzuziehen, kann man konsequent auf die gutachterlichen Feststellungen verweisen. Im Idealfall reguliert die Versicherung den Schaden zeitnah und überweist den fälligen Betrag (Reparaturkosten, Wertminderung, Ausfallentschädigung etc.) auf das Konto des Geschädigten oder direkt an die Werkstatt. Je schneller das Gutachten nach dem Unfall vorlag, desto früher konnte dieser Prozess angestoßen werden – und desto schneller ist das Geld beim Geschädigten bzw. das Fahrzeug repariert.
Abschließend sei erwähnt: Das Unfallgutachten ist auch archivmäßig bedeutsam. Sollten später noch Probleme auftreten (z.B. ein versteckter Mangel, der nicht im Gutachten stand), hat man ein Dokument, auf das man sich beziehen kann. Ebenso bleibt das Gutachten Teil der Schadenshistorie des Fahrzeugs – beim Verkauf kann es als Nachweis dienen, was repariert wurde und wie der Schadenumfang war. Im Versicherungsprozess jedoch ist sein primärer Zweck, dem Geschädigten zu einer vollständigen und fairen Kompensation zu verhelfen. Es fungiert als objektive Verhandlungsgrundlage gegenüber der Versicherung.
6. Fazit: Schnell handeln und professionellen Rat nutzen
Für Gründer und Selbstständige in Berlin kann ein Verkehrsunfall schnell zur existenziellen Bedrohung für den Geschäftsbetrieb werden – umso wichtiger ist eine rasche und professionelle Schadensregulierung. Ein schnelles Unfallgutachten bildet dabei den Grundpfeiler, auf dem alle weiteren Schritte aufbauen. Es ermöglicht, die berechtigten Ansprüche zügig und vollständig bei der Versicherung geltend zu machen, und minimiert die Dauer, in der das eigene Unternehmen ohne fahrbaren Untersatz dasteht. Gerade in einer Großstadt wie Berlin, wo Mobilität und Tempo über Erfolg entscheiden, zahlt es sich aus, keine Zeit zu verlieren.
Abschließend der Rat: Handeln Sie proaktiv nach einem Unfall. Sichern Sie Beweise, schalten Sie einen unabhängigen Gutachter und gegebenenfalls einen Anwalt ein, und informieren Sie die Versicherung umgehend. Mit kompetenter Unterstützung – etwa durch erfahrene Kfz-Gutachter in Berlin – lassen sich typische Fallstricke vermeiden und die Schadenregulierung erheblich beschleunigen. So können Sie sich bald wieder auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, während die finanziellen Folgen des Unfalls durch die Versicherung ausgeglichen werden.
Letztlich bedeutet ein schnelles Unfallgutachten für Selbstständige vor allem: schnell zurück auf die Straße und zurück zum Business-Alltag – mit minimalem wirtschaftlichem Schaden.
Ein Beitrag von Peter Schmitz aus Berlin
Titelfoto: Tumisu from Pixabay